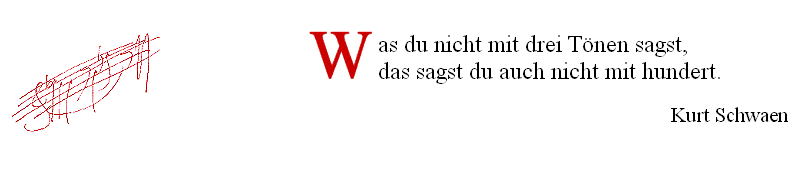Lehrstück (CD »Die Horatier und die Kuriatier«)
Bertolt Brecht / Kurt Schwaen: Die Horatier und die Kuriatier.
Ein Lehrstück mit Musik
- Der Aufmarsch
- Die Schlacht der Bogenschützen
- Die Schlacht der Lanzenträger
- Die Schlacht der Schwertkämpfer
Das Werk
(Auszug aus dem Booklet-Text)
Viele Dinge sind in einem Ding: ein lapidarer wie einprägsamer Satz – zugleich eine Aussage voller Dialektik. Das Denken, vor allem das auf Politik und Gesellschaft gerichtete, in dieser Methode zu schulen, ist Anliegen der »Lehrstücke« von Bertolt Brecht. Die Horatier und die Kuriatier, das letzte Bühnenwerk des Dichters mit solch didaktischer Intention, benennen die einem »Ding« innewohnende Dialektik am Beispiel der Sieben Lanzenverwertungen: Die Lanze, an sich eine Waffe, dient – je nach Situation – als Stütze beim Marsch übers Gebirge, als Lot, um die Tiefe einer Felsspalte zu erkunden, als Sprung- wie als Balancierstab und anderes mehr. Selbst die Natur, die Sonne in ihrem Tageslauf, umgibt das Geschehen nicht als äußerlich-»neutrales« Element. Nach Maßgabe der Handlung verändert sie die Lage der Akteure, begünstigend oder erschwerend.
Für den praktischen Nutzen dialektischen Denkens, um den es Brecht stets zu tun war, stehen nicht nur die einzelnen Begebenheiten des Stücks, er ist vielmehr aus der gesamten Fabelführung zu ziehen. Und diese modifiziert den historischen Stoff, dem das Werk entlehnt ist, erheblich. (...)
Der Sieg der Horatier legitimiert sich in der Folgerichtigkeit ihres Handelns, nicht in der moralischen Überlegenheit, die sie gegenüber ihren Angreifern allerdings auch besitzen. Womöglich wollte Brecht solch objektive Sicht befördern, als er – anders als in ersten szenischen Entwürfen – davon absah, den einzelnen Kämpfern Namen zu geben. Keine »Helden« also sind die Akteure, sondern Personentypen, »entindividualisiert«, um drei Funktionen in einem zu verkörpern: als Heerführer, als Truppenteil und Einzelkämpfer.
Im Falle der Horatier und der Kuriatier erweist sich die Musik als unentbehrlich, um den von Brecht angestrebten Lehrstückcharakter zu unterstreichen – eine Musik freilich, die sich nicht in den Vordergrund drängt, weder psychologisierend noch illustrativ daherkommt. Ihre Funktion: dramaturgische Akzente zu setzen, das Geschehen zu kommentieren, die zu theatralischer Anschauung gebrachten Denkoperationen, also die spielerisch praktizierte »Dialektik«, in Tönen mit zu vollziehen. Das ist etwas anderes als eine bloße Textvertonung, die im Wesentlichen dem sprachlichen Gestus der Dichtung folgt. Vielmehr geht es darum, der Handlung ihre Dynamik zu verleihen, die szenisch nur andeutungsweise »sichtbar« gemachten Vorgänge in eine zeitlich strukturierte, in eine »hörbare« Aktion umzusetzen.
Brecht war sich dieser eminent wichtigen Rolle der Musik von vornherein bewußt. An seinen Freund Hanns Eisler, auf dessen Mitarbeit er zunächst rechnete, schrieb er im September 1935:
»Die Musikfrage ist diesmal wirklich nicht ganz einfach... So, wie es gegenwärtig ist, kann kaum alles gesungen werden. Aber überall ist Musik nötig, da auch die Bewegung der Heere ja genau fixiert werden muß.«
Zur vollen Zufriedenheit des Autors gelöst wurde die »Musikfrage« erst viele Jahre später. Zwar hatte Eisler im August 1935 mit der Komposition begonnen, doch wurde das Projekt wegen einer Verstimmung zwischen beiden unterbrochen und nicht wieder aufgenommen. Damit war das Stück, das Walter Benjamin immerhin für das »vollkommenste« der Brechtschen Lehrstücke hielt, für längere Zeit im Grunde nicht lebensfähig.
1955 schließlich bot Brecht seine Horatier Kurt Schwaen an, den er schon zuvor bei anderer Gelegenheit schätzen gelernt hatte. Für den damals 46jährigen Komponisten war die Beschäftigung mit diesem Werk gewiß der Höhepunkt seiner – wegen des frühen Todes des Dichters – nur kurzen Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht. In Erinnerung daran notierte Schwaen später:
»Im Oktober (1955) fing ich mit der Komposition an. Als ich einige Nummern fertig hatte, spielte ich sie Brecht vor. Er war sichtlich befriedigt. Nach dem ersten Teil meinte er, die Musik sei farbig und hätte Größe (und dies am Klavier, wie hörte er das?). Lange sprachen wir über die ´Sieben Lanzenverwertungen´. Ausgehend von der Dialektik – seinem Lieblingsthema – wünschte er, daß Gegensätze wirksam werden müßten.«
Offenbar hatte Kurt Schwaen den »musikalischen Nerv« des Dichters genau getroffen, was sich nochmals bestätigte, als er ihm eine Tonbandaufzeichnung mit dem Rundfunkchor Leipzig unter Herbert Kegel vorführte. Schon die Orchesterbesetzung (nur Bläser, Schlagzeug, Klavier und Kontrabaß) entsprach Brechts Vorstellungen und Vorschlägen (er liebte Geigen nicht). Erst recht mochte ihn die einfache musikalische Diktion beeindruckt haben, eine Einfachheit allerdings, die es in sich hat, soll sie klanglich überzeugend realisiert werden.
Aufmerksamkeit für den Einzelton, Sensibilität für das musikalische Detail, für die Intensität, die Ausdruckskraft ganz elementarer Tonfolgen oder rhythmischer Figuren zu wecken – darin nämlich besteht die spezifische Schwierigkeit des »Einfachen« und die besondere Herausforderung für die Interpreten. Auf einen kurzen Nenner gebracht, findet man bei Schwaen in Tönen, was man bei Brecht in Worten findet: nämlich die Fähigkeit, in knappen und präzisen Formulierungen komplexe Zusammenhänge darzustellen; die Fähigkeit und das geradezu spielerische Vergnügen daran, selbst in unscheinbaren Begebenheiten so etwas wie »Dialektik« aufzuspüren und anschaulich zu machen.
Dieser Einfachheit im Sinne von gedanklicher Klarheit begegnet man in der musikalischen Struktur auf vielfache Weise: keine größeren Intervallsprünge, häufige rhythmische und tonliche Repetition, Einstimmigkeit der Chöre. Rationalität wird so zur Eindringlichkeit, bekommt damit erst eine emotionale Qualität: im kämpferischen Gestus des Aufmarschs etwa, im klagenden Ton der horatischen und kuriatischen Frauen (die bezeichnenderweise die gleiche Musik verwenden) oder auch in der freudigen Stimmung des Schlußchores, dem Siegeshymnus der Horatier. Ansonsten aber enthält sich die Musik weitgehend der emotionalen Charakterisierung, ist damit alles andere als »opernhaft«. Im Vordergrund steht eher der sachliche Kommentar zum Handlungsgeschehen – in den Chören ohnehin, da sie sich von der textlichen Diktion nur wenig entfernen, stellenweise sogar sprechend agieren. Aber auch die instrumentalen Zwischenspiele sind funktional, stellen sich in den Dienst der Stückdramaturgie. An markanter Stelle, den Sieben Lanzenverwertungen, findet die wesentliche »Lehre« des Stücks – nämlich, daß der Wechsel der Bedingungen einen Wechsel der Mittel erfordert – ihre direkte musikalische Analogie: in Gestalt von sieben Variationen.
Alles in allem erweist sich die Genrebezeichnung »Lehrstück mit Musik« gegenüber dem gelegentlich auch verwendeten Begriff »Schuloper« für die Horatier und die Kuriatier als die treffendere. Letzterer verweist zwar auf die Möglichkeit, das Werk auch mit Kindern und Jugendlichen aufzuführen, engt aber den Adressatenkreis zu sehr ein. Auch verfehlt er die spezifische Rolle, die der Musik hier zugedacht ist: einerseits »mehr« zu sein als eine bloße Bühnenmusik, anderseits ganz im Dienst des epischen Theaters zu stehen.
Michael Dasche